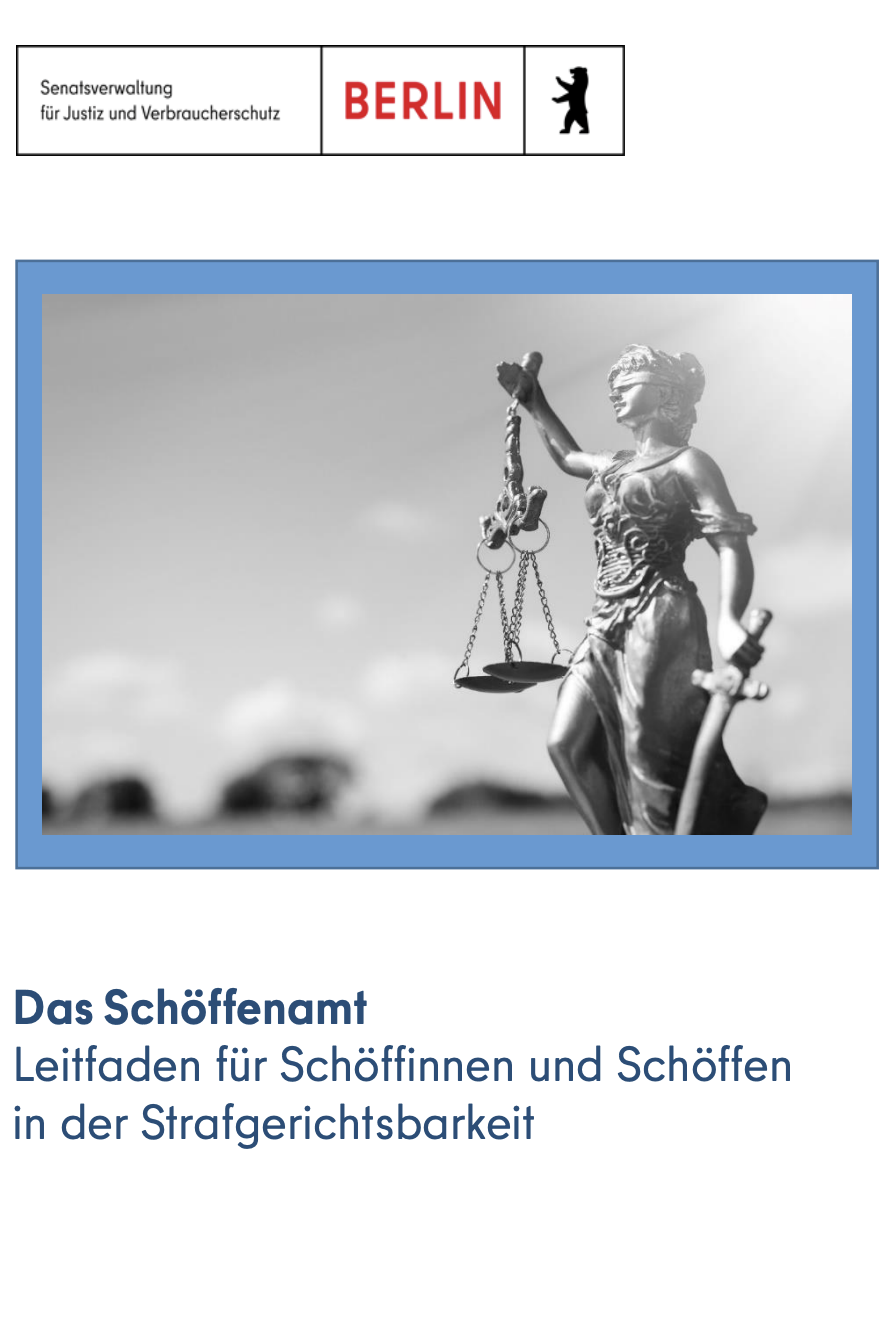Der Rechtsausschuss des Deutschen Bundestages hat sich am Mittwoch, 17. Januar 2024, in einer Anhörung mit einer von der Bundesregierung geplanten Änderung des Deutschen Richtergesetzes (20/8761) befasst. Demnach sollen ehrenamtliche Richter, also Schöffinnen und Schöffen, künftig zwingend nicht berufen werden dürfen, wenn an ihrer Verfassungstreue Zweifel bestehen. Die Sachverständigen begrüßten die Änderung übereinstimmend, vor allem die von der Unionsfraktion benannten sahen aber revisionsrechtliche Probleme. Die Bundesregierung will mit der Regelung nach eigenem Bekunden explizit ein politisches Signal senden, da rechte und rechtsextreme Gruppen ihre Anhänger dazu aufrufen würden, sich als Schöffinnen oder Schöffen zu bewerben.
Für alle Interessierten ist die Sitzung durch das Parlamentsfernsehen abrufbar sowie die weitergehenden Dokumente, Stellungnahmen und Zusammenfassung der Sitzung.
Auch der Präsident unserer Bundesvereinigung wurde als Sachverständiger angehört.
Link zur Seite des Rechtsausschusses des Deutschen Bundestages:
https://www.bundestag.de/dokumente/textarchiv/2024/kw03-pa-recht-richtergesetz-985014
Die Stellungnahme des Bundesverbandes der ehrenamtlichen Richterinnen und Richter finden Sie hier: